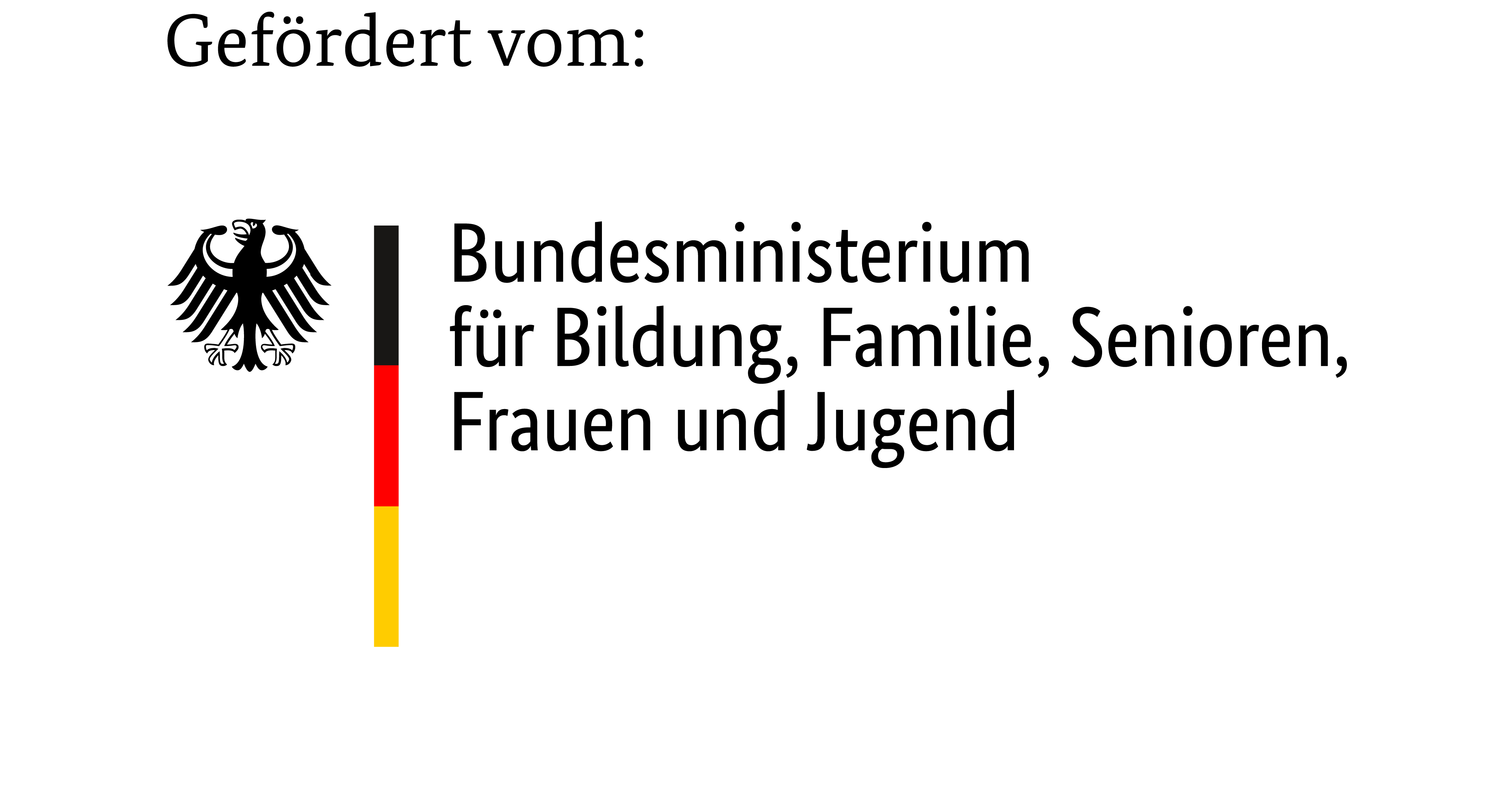„Zu erkennen, dass Verschiedenheit nicht endgültig und dauerhaft ist…“
20 junge Erwachsene aus Deutschland und Israel trafen sich zwischen dem 10. und 17. März zur Rückbegegnung ihres Austauschprogramms im Rahmen des Projekts „Living Diversity in Germany and Israel – Challenges and Perspectives for Education and Youth Exchange“. Es wird von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch und der Israeli Youth Exchange Authority in Zusammenarbeit mit dem Multikulturellen Forum e.V. und dem Hebrew Scouts Movement in Israel organisiert und durchgeführt.
Zu erkennen, dass Verschiedenheit nicht endgültig und dauerhaft ist –
Das ist es, was am Ende zählt.
Dies waren die abschließenden Worte, mit denen die Teilnehmenden ihre gewonnenen Erfahrungen aus dem Austauschprogramm „Your Story Moves – Encounters of Young People in Migration Societies“ zusammenfassten. Nach einer gemeinsam verbrachten Woche im Oktober 2018 in Israel war es nun an den deutschen Teilnehmenden, ihre israelischen Freund*innen in Dortmund zu empfangen und das Thema „Deutschland und Israel als Migrationsgesellschaften“ um neues Wissen und Einblicke zu erweitern.
Nach der Freude des Wiedersehens und einigen Übungen zum Warmwerden begann das Programm mit einem selbstorganisierten Stadtspaziergang in Dortmund. Die Teilnehmenden aus Deutschland zeigten der Gruppe ihre Lieblingsstraßen, die Orte an denen sie normalerweise ihre Zeit verbringen und auch Teile der Stadt, die ihnen etwas besonderes bedeuten. An einer der Stationen der Tour trafen sich die Teilnehmenden mit Stadträtin Daniela Schneckenburger, die die Reinoldikirche als bedeutsamen Ort ausgewählt hatte, um über die Geschichte Dortmunds zu sprechen. „Dortmund ist eine multikulturelle und multireligiöse Stadt, und wir können uns die Stadt nicht ohne ihre Geschichte von Migration vorstellen“, erklärte Frau Schneckenburger. „Rechtsextremist*innen haben vor einigen Jahren versucht, diese Kirche zu besetzen und Neonaziparolen an die Kirchenglocken zu hängen. Wir haben die Glocken laut geläutet und sie von hier vertrieben“, ergänzte sie.
Die Teilnehmenden setzten den Tag fort, indem sie ihre persönlichen Migrationsgeschichten teilten und erläuterten, wie diese ihr Leben beeinflusst haben. Wie definieren sie sich selbst? Wie beantworten sie Fragen, in denen es um Identität geht? Wo fühlen sie sich zuhause und wie ändert sich dieses Gefühl womöglich im Laufe der Zeit? Während einer Einheit zur Lebendigen Bibliothek, in der die Teilnehmenden sowohl als Bücher als auch als Leser*innen auftraten, teilten sie wichtige Lebensgeschichten und kamen sich 6 Monate nach der ersten Begegnung wieder richtig nahe. „Wir haben so viel gemeinsam. Wir bringen komplett verschiedene Hintergründe mit, und doch haben wir auf sehr ähnliche Weise erfahren, was es bedeutet anders zu sein, etwas Einzigartiges zu haben, was dich dein ganzes Leben lang begleitet“, sagte eine*r der Teilnehmenden.
Jugendarbeit und Jugendbeteiligung in Dortmund: Trotz des kalten Wetters und des Regens begab sich die Gruppe mit Fahrrädern auf den Weg in die Nordstadt, einen Stadtteil mit Bevölkerung mit hohem Migrationsanteil. Menschen aus 138 Ländern leben in der Nordstadt – ein richtiges Kaleidoskop der Welt. Mit der Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Weltanschauungen gehen auch Herausforderungen und Strategien der Inklusion und Integration einher. Der Jugendarbeiter Mirza Demirovic aus Dortmund führte die Gruppe durch die Nordstadt und stellte ihr die Jugendclubs und Beispiele gelungener Inklusion vor. „Ich fühle mich hier inspiriert“, bemerkte einer der Teilnehmenden, der mit benachteiligten Jugendlichen in seinem Stamm der Pfadfinder*innen in Israel arbeitet. „In Deutschland gibt es viel mehr Ressourcen, aber ich denke dass ich viele der Ideen, die ich hier gesammelt habe, auch mit meiner Gruppe von Jugendlichen verwirklichen kann“, ergänzte er.
Umgang mit der Geschichte: Ein inspirierendes Team von vier jungen Mädchen lud die Teilnehmenden ein, gemeinsam die jüdische Geschichte der Stadt Dortmund zu entdecken. Als Teil des Jugendrings Dortmund bieten diese Jugendlichen freiwillig Bildungsangebote für Gleichaltrige an, darunter Stolpersteintouren und Biographiearbeit zu jüdischen Persönlichkeiten der Stadt, die während der Zeit des Naziregimes verfolgt und ermordet worden sind. „Die Kultur des Erinnerns unterscheidet sich zwischen Israel und Deutschland irgendwie. In Israel haben wir einen Tag – den Yom HaShoah – an dem wir der Opfer des Holocaust gedenken. Hier sehen wir eine Gruppe junger Leute, die das fast jeden Tag freiwillig machen. Zuerst dachte ich ‚Wofür machen sie das? Die haben doch biographisch kaum Bezug zum Thema des Nationalsozialismus‘. Jetzt verstehe ich, dass wir so viel mehr tun können, um die Erinnerung lebendig zu halten“, sagte eine Teilnehmerin aus der israelischen Gruppe während einer Reflexionseinheit mit Bezug auf die Gegenwartsbedeutung der Shoah für junge Deutsche und Israelis. Die Gruppe behandelte das Thema außerdem während eines Workshops zu Rassismus und Antisemitismus, der von Bildner*innen der Partnerorganisation Multikulturelles Forum angeboten wurde.
Das Programm wäre nicht vollständig gewesen, ohne die religiöse Vielfalt der Region zu behandeln. Der Kölner Dom, die Große Moschee, die Alevitische Gemeinde und die Synagoge in Dortmund waren einige der Stationen, die die Teilnehmenden besuchten. Sie tauschten sich aus und lernten viel über Bräuche und Rituale, sie genossen die Gastfreundschaft der verschiedenen Gemeinden und erlebten, wie schillernd die Palette der religiösen Traditionen ist. Gleichzeitig erkannten sie erneut, wie viele Gemeinsamkeiten die drei monotheistischen Religionen haben und wie interreligiöser Dialog als ein Werkzeug in die diversitätsbewusste Bildung integriert werden kann.
„Wir waren schon immer eine Migrationsgesellschaft. Europa kann nicht ohne Migration verstanden werden“: Dies waren die Worte von Dr. Robert Fuchs, Leiter von DOMiD (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V.), während er ein Bild deutscher Arbeiter in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte. „Das hätte mein türkischer Großvater in den 60er-Jahren sein können. Er hat in einer Kohlemine gearbeitet“, sagte eine der Teilnehmenden, deren Familie aus der Türkei nach Deutschland eingewandert ist. Wann begann die deutsche Migrationsgeschichte? Welche Bevölkerungsgruppen haben sie geformt? Wie erinnern wir heute an sie? Dr. Fuchs stellte der Gruppe die wichtigen Meilensteine deutscher Migrationsgeschichte vor, welche die Teilnehmenden mit ihren eigenen biographischen Narrativen verknüpften. Jede*r von ihnen konnte wenigstens eine Geschichte dazu teilen: Geschichten von Heimatland, von Verlust und Härten; aber auch Geschichten von Mut, Reisen, Lernen und Zugehörigkeit; Geschichten, die sowohl in Israel als auch in Deutschland stattgefunden haben könnten; Geschichten, die es wert sind, bewahrt, geteilt und fortgesetzt zu werden.
Migration hier
Migration dort
'Haters gonna hate' überall (sinngemäß: Wer hassen will, hasst eh, egal was man tut)
Die eine Sache, auf die du dich fokussieren solltest:
Sei DU SELBST und nicht einfach irgendjemand.
Zu erkennen, dass Verschiedenheit nicht endgültig und dauerhaft ist
Das ist es, was am Ende zählt.“
(geschrieben von den Teilnehmenden von „Your Story Moves I“)
Möchten Sie mehr zum Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ erfahren? Schauen Sie unter https://living-diversity.org.
Das Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ wird von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch in Kooperation mit der Israel Youth Exchange Authority realisiert. Es wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und von 2015 bis 2019 als Begleitprojekt durchgeführt.