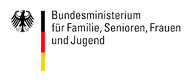„Ich will, dass ich akzeptiert werde für das, was ich bin.“
Masaneh Ceesay ist 27, Dialogmoderator und Alumnus von „Dialog macht Schule“, einer der Partnerorganisationen, die im Rahmen des Austauschprogramms „Your Story Moves! – Begegnungen junger Menschen in Migrationsgesellschaften“ in den deutsch-israelischen Jugendaustausch eingestiegen sind. Er ist kommt aus Wiesbaden, wohnt in Berlin und arbeitet als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Im Oktober 2018 und April 2019 hat er am Austauschprogram „Your Story Moves!“ in Israel und Deutschland teilgenommen.
Was verbindet dich mit dem Thema „Migration“ und wie bist du zu diesem Projekt gekommen?
Es betrifft mich ganz direkt. Mein Name ist offensichtlich nicht Deutsch und das ist auch gut so, denn mein Vater ist aus Gambia. Er ist Anfang der 80er Jahre nach Deutschland ausgewandert. Hier hat er meine Mutter kennengelernt, und dann Liebe. Meine Mutter ist extrem deutsch, deswegen bin ich ziemlich genau in der Mitte, auch was den Phänotyp betrifft. Ich bin Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Das heißt, vom Beruf her habe ich mit den verschiedensten Kulturen zu tun. Zu „Your Story Moves“ bin ich gekommen, weil ich die Ausbildung zum Dialogmoderator bei „Dialog macht Schule“ gemacht habe. In diesem Projekt gehen die Fachkräfte in Berliner Schulen und setzen sich dort mit dem staatlichen Schulwesen auseinander. Die Idee des Projektes war es, ein Demokratieförderprogramm mit den Schülern zu entwickeln, den Unterricht nach ihren Interessen zu gestalten und dabei ihre Ansichten als Ausgangsperspektive zu nutzen. Wie auch das Sprichwort sagt: „Sie dort abholen, wo sie stehen“.
Du meintest eben, deine Mutter sei typisch deutsch. Glaubst du an so etwas wie typisch deutsch oder typisch israelisch?
An dieser Stelle ist eine Unterscheidung notwendig. Mit typisch deutsch habe ich nicht primär Charaktereigenschaften sondern ihren Phänotyp gemeint. Meine Mutter ist super blass und hat Sommersprossen und mein Vater ist schwarz wie die Nacht. Meine Aussage bezieht sich nur auf das Aussehen. Es spielt in meinem Leben eine große Rolle, da ich nicht typisch deutsch aussehe. Ich kann mich so gut ausdrücken, wie ich will. Zudem bin ich Deutschlehrer und ein „Grammatiknazi“ sondergleichen. Wenn Leute mich anschauen, denken sie, dass ich von irgendwoher komme – aber bestimmt nicht aus Hessen. Wenn wir über sowas wie typische Eigenschaften reden, sind wir gleich im Gebiet der Klischees und Stereotype. Nichtsdestotrotz wird sowas genutzt oder reproduziert.
Wie prägt das dein Leben, als Deutscher in Deutschland zu leben, aber dabei nicht wie der typische Deutsche auszusehen?
Mir wird oft die Frage „Woher kommst du?“ gestellt. Ich gebe diese Frage gelegentlich einfach zurück oder gebe eine simple Antwort. Das Problem ist, dass viele Menschen denken, dass Rassismus von den Absichten abhängt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht gar nicht darum, ob böse Absichten vorliegen oder nicht. Es geht um die Aussage, unabhängig von der dahinterstehenden Absicht. Gestern habe ich ein Paket von meinem Nachbarn abgeholt und er hat mir geantwortet: „Ja, auch wenn ich Ihren Namen nicht aussprechen kann.“ Er hätte es wenigstens versuchen können. Gemäß der deutschen Phonetik kann mein Vorname ganz gut ausgesprochen werden, und beim Nachnamen sei es drum. Auf meiner ehemaligen Arbeitsstelle, habe ich einmal zu einer Kollegin gesagt, dass mich die ganze Rassismus-Thematik nervt, weil es immer heißt, dass ich als nicht-weiße Person mich erklären soll. Ich habe wörtlich entgegnet: „Das ist euer Problem, darum müsst ihr euch kümmern!“, und sie war sehr empört, dass ich sie als Weiße markiert habe. All diese kleinen Dinge sind dauerhaft in meinem Leben präsent. Auf alle Dinge einzugehen, wäre für mich viel zu anstrengend, deshalb lasse ich die meisten einfach nur im Raum stehen.
Du arbeitest als Lehrer Tag für Tag mit Leuten zusammen, die ähnliche Erfahrungen machen. Was gibst du ihnen mit auf den Weg? Sollen sie darauf reagieren oder es am besten ignorieren?
Tatsächlich finde ich es ganz gut, Deutschlehrer zu sein, denn ich bin nicht nur dafür zuständig, die Sprache zu vermitteln, sondern auch Landeskunde – so wird es geschimpft! – zu unterrichten. Es ist meine Aufgabe, einen Einblick in die deutsche Gesellschaft zu geben. Da ist es hilfreich, dass ich sozusagen an der Front stehe; ich kann ihnen damit die Vielfältigkeit in Deutschland zeigen aber auch über Probleme reden, die wir haben. Ich habe oft Schüler erlebt, die bei Themen wie dem NSU-Komplex erstaunt bzw. schockiert waren. Ich sitze im Moment an einer Art Schalter, mit dem ich das Deutschlanderlebnis meiner Schüler beeinflusse. Daher bin ich ganz froh, so zu sein, wie ich bin. Ich bringe ihnen zwar Deutsch bei, aber ich sehe nicht so aus. Auf der einen Seite nervt es mich, wenn Leute sagen, dass ich aufgrund meines Aussehens kein Deutscher wäre. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich nicht phänotypisch aussehe. Die Frage ist nicht, ob das so ist oder nicht, sondern was damit verknüpft wird. Ob jemand der braun oder dunkelhäutig ist, überhaupt Deutscher sein kann. Ich habe null Akzent, höchstens einen hessischen Dialekt. Alles außer meiner Hautfarbe spricht dagegen, dass ich fremd bin.
In Israel hast du gesagt, dass du das Gefühlt hattest, dort „undercover“ unterwegs zu sein, ohne wegen deiner Hautfarbe aufzufallen. Hättest du damit gerechnet, dass du in Israel diese Freiheit erleben würdest?
Bevor wir nach Israel geflogen sind, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, welche Erfahrungen ich im Bezug auf meine Person machen könnte. Ich habe mehr über die größeren politischen Themen nachgedacht und darüber, dass während des Austausches inhaltlich sehr viel Nachholbedarf besteht. Am zweiten oder dritten Tag ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es scheinbar überhaupt niemanden großartig zu kümmern scheint, dass ich dort unterwegs bin. Da war ich positiv überrascht. Wenn ich in Deutschland rumlaufe, ziehe ich die Blicke der Leute auf mich. Ich glaube, dass es jedem so geht, der anders aussieht. Manchmal ist es schwer, die Blicke der Leute zu deuten. Der eine wird sagen, dass ich übermäßig doll tätowiert bin, obwohl ich so standard hipster-mäßig tätowiert bin wie halb Berlin. Das Problem ist, dass ich die Blicke nicht unterscheiden kann.
Das Thema des Austauschs waren junge Menschen in einer Migrationsgesellschaft. Konntest du Israel überhaupt mit Migration verbinden? Was war dein Blick vorher und nachher?
Ich hatte einen Überblick über die Geschichte des Staates Israel. Ich wusste, wie der Staat von seinem Setup gegründet wurde und dass die Idee der Nation aus Einwanderung bestand. Wobei die arabische Bevölkerung nicht vergessen werden sollte – sie war schon vorher da. Israel ist ein Einwanderungsprojekt, welches nicht erst mit der Shoah angefangen hat. Daher hat es mich nicht verwundert, dass dort eine bunt zusammengewürfelte ethnische Mischung vorhanden ist. Darauf basierend ist mir nach ein paar Tagen aufgefallen, dass Israel mit einer so diversen Bevölkerung aufgebaut wurde, dass es nicht so besonders ist, schwarz zu sein. Vermutlich kommen die Schwarzen aus Äthiopien oder Eritrea und haben auch in Israel keinen leichten Stand. Es ist ähnlich in manchen Orten in Deutschland. Ich war einmal mit einem iranischen Freund in einem Supermarkt in Cottbus. Dort wurden wir wie Außerirdische angeschaut. Ich habe „Hallo“ zu der Kassiererin gesagt und sie hat mich nur wie einen Roboter angeschaut. Das gibt es in Deutschland an vielen Ecken und Enden. Ich habe auch immer „Glück“ mit meinen Nachbarn, die sind auch immer solche Idioten. Sie sagen, dass ich angeblich Scheiß‘ in meiner Wohnung mache und ich gefälligst für die deutschen Gaben dankbar sein soll. In Wiesbaden war meine Nachbarin der Meinung, dass ich jede Nacht meine Möbel zertrümmere und daher jeden Tag zu Ikea fahre, um neue Möbel zu kaufen. Einer meiner anderen Nachbarn hatte psychische Probleme und randalierte nachts. Aber sie war sich ziemlich sicher, dass ich das war, weil halt…. Wer soll es sonst sein, wenn nicht ich! Als ich sie zur Rede gestellt habe, kam raus, dass ich zu besagtem Zeitpunkt nicht einmal anwesend war. Ihre Antwort war nur, dass ich dankbar dafür sein soll, was mir das Land gibt. Wovon redete sie überhaupt? Was sollte der rassistische Scheiß‘? Ihre Antwort – Achtung, es wird witzig! – war: „Ich bin auch Immigrantin. Ich bin Halbamerikanerin.“
Machst du das auch, Dinge in deinem Kopf vorher schon einmal aussprechen, bevor sie dir von anderen gesagt werden?
Ja, so habe ich meine Jugendzeit überstanden. Deswegen bin ich vermutlich jetzt auch so zynisch. Ich habe durchgehend Witze über Schwarze gemacht, damit sonst niemand anderes welche machen kann. Ich habe immer alle dummen Sprüche rausgehauen, die allgemein bekannt sind, und mich immer selbst parodiert. Aber mit 20 Jahren hatte ich dann keinen Bock mehr darauf, und ich habe dann einfach „F*ck dich“ gesagt. Sie haben nur gefragt, warum ich denn jetzt so aggro wäre, obwohl das nur ein minimaler Teil der Aggressivität war. Genau darüber habe ich bei unserem Austausch in Haifa bei der Methode „Lebendige Bibliothek“ nachgedacht, als ich 20 Minuten darüber reden konnte.
Würdest du als Lehrer sagen, dass wir mehr Biographiearbeit benötigen?
Biographiearbeit wird auf jeden Fall mehr benötigt. Als ich in der Schule war, herrschte in Hessen und auch an Berliner Schulen zufälligerweise ein Migrationsanteil von 1000 %. Wenn genauer hingeschaut wird, wird deutlich, dass Fächer wie Politik und Geschichte einem hegemonialen, männlichen und weißen Narrativ unterliegen. Es wird biographische Arbeit benötigt, die die Schüler wirklich fragt: „Wer bist du eigentlich und als was siehst du dich selbst?“ Damit können wir die kollektiven Narrative angreifen. Das ist dringend notwendig. Schulen sollten eigentlich Orte sein, in denen sich die Schüler selbst entwickeln können, um dann später die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Dafür ist Biographiearbeit und Empowerment wichtig. Die Schüler merken dadurch, dass ihre Perspektiven etwas wert sind. In der Schule wird Mehrsprachigkeit auch als mangelnde Deutschkenntnis ausgelegt. Die Bundesregierung redet von Diversität – jedes Draftbook hat Leute aus aller Welt auf dem Cover –, aber das war es dann.
Der Fokus sollte nicht darauf gelegt werden, der ominösen deutschen Mehrheitsgesellschaft zuzuhören. Etwas, das mich bei „Dialog macht Schule“ gestört hat, ist, dass von Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft geredet wurde, als wäre das das einzige Ziel, das wir haben können. Ich will nicht deutscher sein als ein x-beliebiger deutscher Politiker, damit ich akzeptiert werde. Ich will, dass ich akzeptiert werde für das, wofür ich mich halte und was ich bin. Das bedeutet nicht automatisch, dass ich kein Teil von Deutschland bin. Abgesehen davon ist Deutschsein nur ein Konstrukt, so wie jede Nationalität. Wenn wir in einen Berliner Kiez hinein zoomen, dann wird deutlich, dass es nicht immer dieses Entweder-Oder gibt. Wir sind so viel Verschiedenes gleichzeitig. Je nachdem wo wir uns befinden, sind wir was anderes. Wenn ich in der Uni bin, dann bin ich ein Nerd, wenn ich beim Fußball bin, wird gepöbelt, und in Israel war ich der deutsche Teilnehmer.
Kann Deutschland etwas zum Thema Diversität von Israel lernen oder kann Israel etwas von Deutschland lernen?
Ich muss ehrlich sein, ich weiß zu wenig über die Diversitätspolitik Israels, um das beurteilen zu können. Aber was in Deutschland massiv fehlt, ist eine kritische Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit. Vielerorts wird gesagt, dass die Shoah ausreichend aufgearbeitet worden ist. Das ist absolut nicht wahr. Wenn das so wäre, hätten wir heute keine AfD im Bundestag. Aber auch die Kolonialgeschichte kommt in der kollektiven Geschichtsschreibung kaum vor, das erste Konzentrationslager war in Afrika. Stattdessen werden Straßen nach Kolonialherren benannt, die Leute in die Wüste getrieben haben. Da muss sich Deutschland, auch im tiefsten Sachsen, endlich seiner Geschichte stellen und anerkennen, dass es das gab und bis heute Auswirkungen hat.
Über die Erarbeitung der Geschichte haben wir viel während des Austauschprogramms gesprochen. Gibt es etwas, das dich diesbezüglich in Israel überrascht hat?
Ein grundlegender Unterschied ist, dass hier an keinem Tag im Jahr die Sirenen läuten. Absurderweise ist nicht einmal der 8. Mai (Tag der Befreiung) ein Feiertag, sondern ein ganz normaler Arbeitstag. Im Vergleich zu Israel ist es um das Gedenken in Deutschland ziemlich erbärmlich gestellt, es wird eigentlich nichts getan. Höchstens sagt ein Politiker „Sorry“ und das war es dann. Aber andererseits kann es ziemlich nervig sein, wie ich in Israel gehört habe, sich retrospektiv damit zu identifizieren, wenn sie aus einer Generation stammen, die damit nicht mehr sehr viel zu tun hat. Größtenteils hat man nur Bezug über die Verwandten, die einem etwas erzählen oder nicht erzählen. Aber ich finde wichtig, dass im Kontext Geschichte exklusive Mechanismen, die schon damals wirksam waren und heute immer noch wirksam sind, erkannt werden. Das ist die wichtige Lektion, die wir von der Geschichte mitnehmen können, da ansonsten Geschichte nur Geschichten erzählen und letzten Endes auch nur ein Weg ist, wie man seine eigene Identität stiften will.
Welche Erfahrungen hast du mit Antisemitismus in der Schule gemacht?
Viele werden es jetzt hassen, was ich sagen werde. Es gibt viele Kulturen, bei denen Antisemitismus vorherrscht, da ist Deutschland nicht ausgenommen. In Deutschland ist es aber auch gang und gäbe, nicht alles zusagen, was gedacht wird. Das habe ich auch in meiner Schulzeit erlebt und später auch in der Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen. Es gibt viele Vorurteile und einen komischen tradierten Antisemitismus, der einfach da ist. Da geht es nicht darum, zu sagen, dass Muslime per Definition antisemitisch sind, sondern dass es Antisemitismus in seiner Herkunftskultur gibt. Dieser muss auch benannt und nicht aus falscher Vorsicht oder falscher Toleranz nicht kritisiert werden, weil Angst existiert, eine Minderheit zu diskriminieren. Aber es geht auch nicht, dass eine Minderheit die andere Minderheit diskriminiert. Ich habe das ziemlich häufig gesehen.
Wissen die Lehrer*innen, wie sie damit umgehen sollen?
Die Lehrer*innen wissen nicht, wie sie auf Konflikte in der Klasse reagieren sollen. Sie haben drakonische Strafen verhängt und die Schüler runtergemacht. Das ist auch ein großes Problem an diesen sogenannten Problemschulen, an denen der Migrationshintergrundanteil groß ist: Lehrer haben einen gewissen gesellschaftlichen Stand und behandeln die Schüler wie Dreck. Dann wundern sie sich, warum die Schüler keinen Bock haben und lieber auf der Straße herumhängen.
Was hat dich noch in Israel überrascht?
Es hat mich total überrascht, dass die israelischen Teilnehmer mindestens genauso viel über sich selbst gelernt haben wie wir über uns. Menschen können ein ganzes Leben nebeneinander existieren, ohne Ahnung von der Lebensrealität der anderen Seite zu haben. Das war ein Aspekt, über den ich noch im Nachhinein nachgedacht habe. Das ist die Diskrepanz zwischen Wissen und Erfahrung. Es kann potenziell Mut machen, sich weiter mit dieser Geschichte rumzuschlagen. Es darf nicht verschwiegen werden, dass das Ganze auch extrem anstrengend sein kann, wobei das ganze Leben mega anstrengend ist. Diversity und alles ist schön, aber es hat auch Schattenseiten, die einem aufgezwungen werden. Darüber zu reden ist extrem wichtig; es reicht nicht, nur fröhlich Bäume zu umarmen. Das Genannte fehlt mir in der deutschen Diversitätspolitik. Das Leid braucht auch ein Ventil. Ich persifliere das immer mit „Alle Rassen singen“, als wäre das die Lösung, nur zu singen, wenn es Probleme gibt. Für die Generationen nach mir gilt, dass ihr auch mit den Leuten reden müsst. Euer vermeintliches Wissen muss mindestens abgeglichen werden mit Leuten, über die geredet wird.
Womit möchtest du unsere Diskussion abschließen?
Du meintest einmal, ob wir alle nicht etwas neurotisch werden, ständig Verteidigungsmechanismen entwickeln zu müssen. Ich habe innerlich eine große Widerstandsfähigkeit, weil ich weiß, wer ich bin und wo ich herkomme. Das kann mir niemand zerreden. Wenn man mit mir fremdelt, also mich als Fremden markiert, dann lasse ich es nicht einmal in die Nähe meiner Schutzzone. Es würde sonst wehtun. Das ist aber davon stark beeinflusst, dass ich hier geboren wurde und Deutsch als Muttersprache gelernt habe. Ich wurde hier sozialisiert. Das Neurotische kenne ich von meiner Frau, die aus Russland eingewandert ist. Sie spricht super Deutsch, ist sich aber häufig unsicher. Zum Beispiel stellt sie Rückfragen wie: „Spreche ich gut genug?“, „Hören die Leute, wo ich her bin?“. Ich beneide sie nicht um dieses Unsicherheitsgefühl. Wie gesagt, jeder hat seine eigenen Kämpfe, aber das Potenzial lieg darin, die Gemeinsamkeit in den Kämpfen zu erkennen.
Möchten Sie mehr zum Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ erfahren? Schauen Sie unter https://living-diversity.org.
Das Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ wird von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch in Kooperation mit der Israel Youth Exchange Authority realisiert. Es wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und von 2015 bis 2019 als Begleitprojekt durchgeführt.