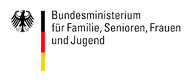„In der Schule reden wir wenig über Identität“
Berfin Kolcak ist Dialogmoderatorin und Alumna von „Dialog macht Schule“, einer der Partnerorganisationen, die im Rahmen des Austauschprograms „Your Story Moves! – Begegnungen junger Menschen in Migrationsgesellschaften“ in den deutsch-israelischen Jugendaustausch eingestiegen sind. Sie ist Masterstudentin der Politikwissenschaften und derzeit wohnhaft für ein Austauschsemester in Australien. Im Oktober 2018 und April 2019 hat sie am Austauschprogram „Your Story Moves!“ in Israel und Deutschland teilgenommen.
Hattest du schon immer Interesse an so einem Austausch oder kam das Angebot auf dich zu?
Ich hatte immer Interesse, an einem solchen Austausch teilzunehmen, vor allem an einem außereuropäischen. Eines Tages war ich in der Uni, ich habe in mein Mail-Fach geschaut und da war das Angebot von „Dialog macht Schule“. Für mich war dann sofort klar, dass ich mich bewerben will.
Hat das Thema der Migrationsgeschichten im Jugendaustausch dein Interesse geweckt?
Auf jeden Fall! Ich bin in der politischen Bildungsarbeit tätig und arbeite mit ganz vielen Leuten mit Migrationshintergrund zusammen. Ich habe selber einen Migrationshintergrund und der Bereich Naher Osten interessiert mich auch sehr, unter anderem weil meine Eltern da herkommen.
Hattest du bestimmte Erwartungen an das Projekt? Was hast du dir vorgestellt oder was hat dich später überrascht?
Da es um einen Austausch mit Israel ging, bin ich davon ausgegangen, dass es ein anti-palästinensisches Projekt ist. Dann habe ich mich erst einmal erkundigt und ich habe gesehen, dass das Projekt in Kooperation mit dem „Arab-Jewish-Community-Center“ stattfindet. Da war es mir klar, dass das keine anti-palästinensische Veranstaltung ist. Man hat Vorurteile über Israel. Ich habe vorher selbst noch keine Israelis in Deutschland kennengelernt und wusste nicht, wie man mit dem Palästinenserkonflikt in Israel umgeht. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt Palästina erwähnen darf. Als ich dann da war, habe ich festgestellt, dass das überhaupt nicht der Fall war. Das hat mich beruhigt und auch glücklich gemacht, dass ich daran teilgenommen habe. Am Ende war alles in Israel ein Highlight, weil alles neu war. Jede Minute war für mich „Wow!“. Es sah schön aus, die Leute waren sympathisch, vor allem die Teilnehmenden. Es war ein offener Raum, wo wir unsere Meinungen austauschen konnten. Mir war gleichzeitig klar, dass ich auf jeden Fall noch mal nach Israel will, um auch weitere Perspektiven kennenzulernen. Ich habe hier eine sehr offene Gruppe erlebt. Es ist auch wichtig für mich, mit anderen Menschen zu diskutieren, die nicht so offen sind. Das gehört dazu, um das Land in der Tiefe zu verstehen.
Würdest du sagen, dass man manchmal ein Schwarz-Weiß-Denken über die Region hat?
Ja, genau. Vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich schon in der Grundschule mit vielen Palästinensern aufgewachsen bin. Ich bin auch immer auf den Medien unterwegs, die die palästinensische Seite darstellen. Wenn man die Videos von den Kindern, dem Krieg und der israelischen Armee sieht, bekommt man immer nur die eine Seite mit. Daher war ich vor dem Projekt vielleicht etwas voreingenommen. Meine Freunde waren auch erstmal etwas schockiert. Sie meinten, ich wisse nicht, welche Organisationen dort unterstützt werden und welche Leute ich kennenlernen würde. Ich erkundigte mich vorher und die Kooperation mit dem „Arab-Jewish-Community-Center“ hat mir schon gezeigt, dass es nicht so sein würde, wie man es sich vorstellt.
Migrationsgeschichten in Israel: Wusstest du, dass Israel ein Migrationsland ist?
Durch die Medien war mir bewusst, dass in Israel viele europäische Juden wohnen. Vor Ort wurden mir die Augen geöffnet und gezeigt, dass dieses Land ein „Melting Pot“ der Kulturen ist. Die Leute kommen aus allen Himmelsrichtungen der Welt und trotzdem sagen sie nicht, dass sie aus Europa kommen, sondern, dass sie Israelis sind.
Ist es in Deutschland anders?
Ja! Wenn mich in Deutschland jemand fragt, wo ich herkomme, dann antworte ich meistens, dass ich Kurdin bin. Es sei denn, die Leute haben mit der Frage eine andere Absicht. Dann sage ich, dass ich Deutsche mit Migrationshintergrund bin. Bei mir ist das situationsabhängig.
Hast du während der Begegnung neue Aspekte in deiner eigenen Migrationsgeschichte entdeckt?
In Israel fand ich es sehr interessant, dass sie sich als Israelis sehen, obwohl ihre Geschichte weit über Israel hinaus geht. Ich dachte mir: „Warum sage ich denn immer, dass ich Kurdin bin? Wieso identifiziere ich mich mit den Kurden, obwohl ich, wenn ich im kurdischen Teil der Türkei bin, nach Deutschland zurück will?“ Wenn ich länger im Ausland bin, vermisse ich Deutschland immer. Da ist immer dieser Konflikt: Bin ich Deutsche oder bin ich Kurdin? Wenn die Leute in Israel sagen, dass sie dort geboren sind und sich dort mit der Kultur identifizieren, wieso sage ich dann „Ich bin nicht Deutsche“? Bei mir gibt es eine Identitätskrise.
Was kann dazu beitragen, dass man mit diesen Fragen nicht so konflikthaft umgehen muss?
Es sollte Energie und Ressourcen in die politische Bildungsarbeit investiert werden. Bei uns wurde im Ethikunterricht nicht über Identitätsthemen gesprochen. Wichtig war eher der strikte Rahmenlehrplan. Wenn ich bei „Dialog macht Schule“ bin, merke ich ganz oft, dass die Schüler selber nicht wissen, was sie sind. Sie denken, dass sie es wissen, aber wenn man sie näher betrachtet und ein paar Fragen stellt, kommen sie selbst in eine Identitätskrise.
Könnten die persönlichen Geschichten und Biografien der jungen Menschen als wichtiger Teil des Lernens dienen?
Wenn wir diese Biografien sichtbar machen, zeigen wir auch, dass wir die Schüler wertschätzen. Sonst fühlen sie sich vom Schulsystem ignoriert. Es ist interessant, zu wissen, was die Kinder mitbringen. Aber meistens bekommen sie den Migrationskind-Stempel und das war es. Keiner interessiert sich, was die Eltern durchgemacht haben oder noch heute durchmachen. Wir beschäftigen uns wenig damit, wie der strukturelle Rassismus noch unser Leben prägt, wie unsere Eltern und auch wir dem Rassismus ausgesetzt sind. Damit meine ich nicht nur den Rassismus von rechter Seite aus sondern ich meine auch die ganzen interkulturellen Konflikte. Mit vielen Türken habe ich als Kurdin auch Rassismus-Erfahrungen gemacht. Wir teilen dieselbe Leidens- und Migrationsgeschichte. Trotz alledem haben wir immer noch den Hass unserer Vorfahren, obwohl der Hass nicht da sein sollte.
Was war dir wichtig, den anderen Teilnehmenden in Berlin zu zeigen?
Offensichtlich mussten sie unbedingt Kreuzberg gesehen haben. (Lachen) Wir hatten in der Schule einen Englandaustausch, und als wir damals mit den Schülern durch Berlin gingen, hieß es: „Oh hier sind ja ganz viele Türken“. Das hat sie überrascht. Kreuzberg in Berlin ist eine Stadt in einer Stadt. Dort leben die Kulturen ganz friedlich zusammen und bereichern sich gegenseitig, wie zum Beispiel mit den Küchen.
Hattest du das Gefühl, dass auch die Israelis mit einer bestimmten Einstellung nach Deutschland gekommen sind, welche sie dann später hinterfragt haben?
Dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich habe unter anderem eine Teilnehmerin gefragt, ob sie noch Hass auf Deutschland verspürt. Man vergisst ja seine Geschichte nicht und ein bisschen Wut bleibt immer bestehen. Ich hatte den Eindruck, dass sie überhaupt keine voreingenommene Meinung hatten. Sie kamen eigentlich alle ganz offen zu uns, ohne Vorwürfe wegen der Vergangenheit. Sie waren bereit, eine neue Perspektive in Deutschland kennenzulernen. Was mich angeht, dachte ich, dass sie mich eher als Kurdin oder „middle-eastern“ und nicht als Deutsche sehen würden. Aber sie haben mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass sie mich mit meiner Kultur sehen, sondern einfach als Menschen.
Wie hast du dich gefühlt, als du festgestellt habt, dass ihr sehr ähnlich seid?
Mein Blick war vorher etwas voreingenommen. Ich folge einigen Seiten, auf denen ich hauptsächlich israelische Frauen mit grünen Augen und braunen Haaren gesehen habe. Ich habe fast schon gedacht, dass alle dort so aussehen. Gleichzeitig wusste ich zum Beispiel, dass viele Äthiopier in Israel leben, und ich dachte, dass das die Teilnehmenden mit Migrationsgeschichte sein werden. Als ich dann die Leute gesehen habe, dachte ich mir, dass sie auch Berliner sein könnten. Wir waren wirklich alle gleich, hatten so viele Gemeinsamkeiten. Ich habe gleich danach meinen Freunden davon erzählt. Am Anfang hatten sie Angst, dass ich Israel besuche. Sie dachten, dass dort die ganze Zeit Bomben fliegen würden. Ich habe ihnen dann erzählt, wie wohl ich mich in Israel gefühlt habe, und sie waren sehr glücklich, so etwas zu hören. Beim nächsten Projekt sind meine Freunde bestimmt dabei. (Lachen)
Hast du etwas Neues gelernt in Bezug auf den Umgang mit der Geschichte?
Wir haben dieses Video gesehen, wie verschiedene Überlebende mit der Shoah umgehen und dann zu „I will Survive“ getanzt haben. Ich habe besonders auf die Reaktion der Israelis geachtet. Sie sind sehr erwachsen und reif damit umgegangen. Ich hätte erwartet, dass sie wütend werden. Von einer Deutschen Perspektive aus denkt man, dass die Personen noch sehr voreingenommen sind. Und sie noch an die Geschichte denken und wütend sind. Aber die Israelis in dieser Gruppe sind gut mit diesem innerlichen Konflikt umgegangen. Sie haben gelernt, damit umzugehen, und gleichzeitig vergessen sie nicht, was passiert ist. Es war sehr überraschend, zu sehen, wie im Vergleich die Deutschen reagiert haben.
Was ist deine Erfahrung zu diesem Thema mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Deutschland gewesen? Ist die Vergangenheit überhaupt für sie relevant?
Ich hatte den Eindruck, dass es sie nicht besonders interessiert hat. Von Schülern habe ich öfters gehört, wie sie „Du Jude“ als Beleidigung genutzt haben. Als ich sie darauf angesprochen habe, haben sie sich mit einem einfachen „sorry“ herausgeredet. Sie haben den hohen Stellenwert so einer Aussage und wie schwerwiegend so etwas sein kann nicht verstanden. Als ich an einem Gymnasium gearbeitet habe, habe ich dort von einem Schüler „Arbeit macht frei“ gehört, und zwar kam das von einem Schüler ohne Migrationshintergrund. So etwas zu hören, hat mich schockiert. Ich fragte mich, was dieser Junge überhaupt im Geschichtsunterricht gelernt hat, ob es in seiner Klasse nie thematisiert wurde oder er es einfach ignoriert hat. Das hat mich richtig traurig gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich jemand fühlen würde, der einen persönlichen oder familiären Bezug zum Holocaust hat und heute sowas hören würde.
Was fehlt in unserem Schulsystem, um sensibler mit dieser Geschichte umzugehen?
So ein Austausch macht sehr viel aus. Wenn man alles nur durch den Bildschirm sieht, kann es leicht verdrängt werden. Wenn man Leute kennenlernt, die eine solche Geschichte durchgemacht haben oder Angehörige verloren haben, dann ändert sich auf jeden Fall die Sichtweise auf die Geschichte. Ich finde die Idee gut, wenn an Schulen mit einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund dieser biografische Bezug mehr in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen mal mit Betroffenen in Kontakt kommen. Leider investiert niemand Zeit und Energie in solche Projekte. Dabei sollten sie schon in der Oberschule oder gar schon in der Grundschule gemacht werden.
Hat dich diese Art von Begegnung persönlich geprägt?
Hauptsächlich was den Nahen Osten angeht. Für mich war das auch nur der Anfang. Ich will so etwas nochmal machen. Vorher habe ich alles über den Palästinakonflikt nur durch den Bildschirm, auf Facebook und Instagram gesehen. Von außen lässt es sich immer ganz leicht reden. Aber erst, wenn man so etwas hautnah miterlebt und Beteiligte kennenlernt, kann man etwas dazu beitragen.
Dafür braucht man auch pädagogisches Werkzeug, was den Fachkräften oft fehlt. Konntest du solches Werkzeug im Rahmen dieses Projekts gewinnen?
Wir müssen lernen, wie wir unsere Emotionen kontrollieren und sie vom Politischen trennen. Als Pädagog*innen in Schulklassen im Rahmen des Projektes „Dialog macht Schule“ sind wir ja auch eine Art Vorbild. Dabei müssen wir zeigen, wie mit solchen Konflikten umgangen werden kann. Ich vergleiche das mit dem Kurdisch-Türkischen Konflikt: Wenn ich als Kurdin über den Konflikt rede, muss ich auch meine Emotionen zurückhalten. Für mich galt immer, keine Emotionen und keine Meinung zu zeigen, sondern neutral bleiben. Das ist zwar schwer, aber muss den Fachkräften beigebracht werden.
Migration ist in Deutschland immer noch ein herausforderndes Thema. Was kann Deutschland von Israel lernen?
In Israel kommt jeder aus einem anderen Land, aber alle identifizieren sich mit einer verbindenden Kultur. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass es nicht so ist. Viele haben noch diesen inneren Konflikt, wie es auch bei mir der Fall ist, und stellen sich die Frage: „Was bin ich?“. Da muss mehr angesetzt werden, um in Deutschland eine verbindende Kultur zu schaffen – damit man beides sein kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen.
Möchten Sie mehr zum Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ erfahren? Schauen Sie unter https://living-diversity.org.
Das Projekt „Living Diversity in Germany and Israel“ wird von ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch in Kooperation mit der Israel Youth Exchange Authority realisiert. Es wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und von 2015 bis 2019 als Begleitprojekt durchgeführt.